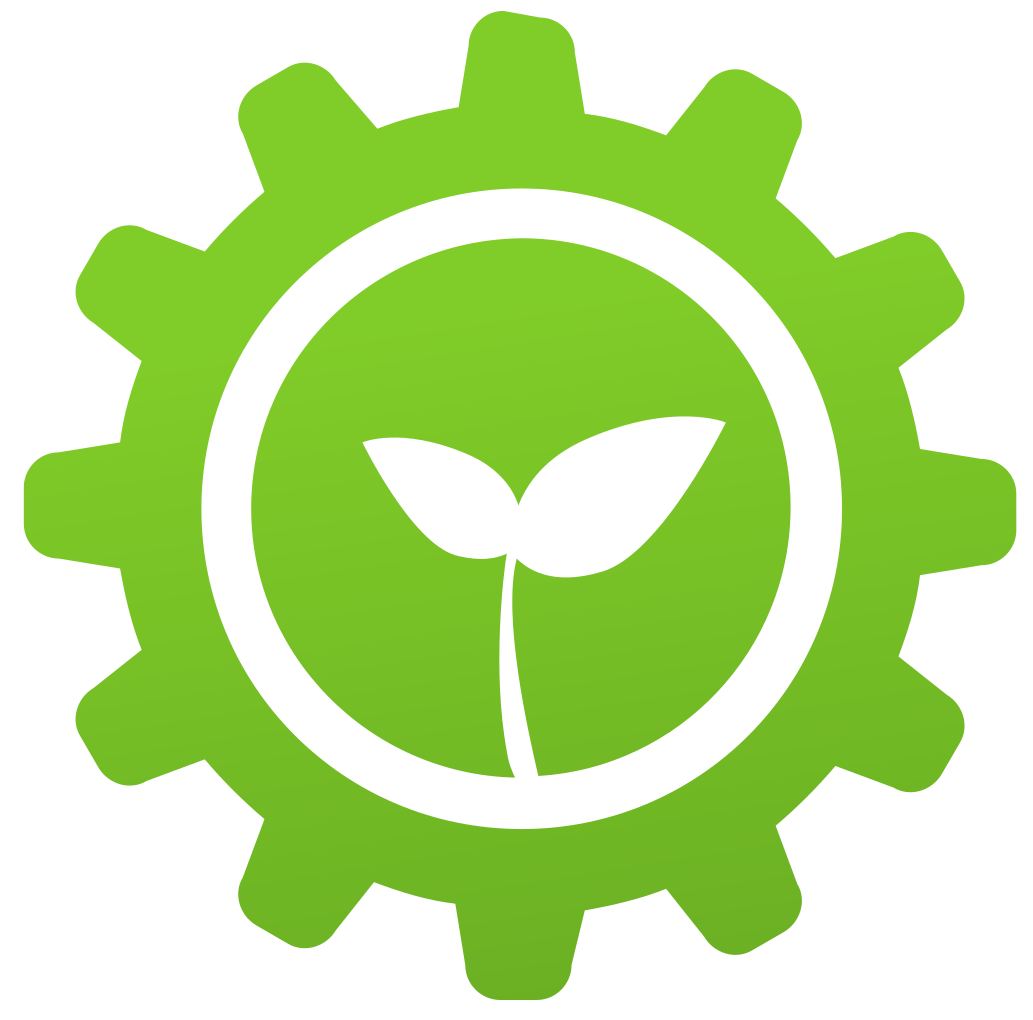 Energiesystem
EnergiesystemWindenergie und Wasserstoff vereint für den Klimaschutz
Zusammenfassung
Wasserstoff kann zum Klimaschutz beitragen, wenn Strom aus erneuerbaren Energien zu seiner Herstellung in der Elektrolyse genutzt wird - sogenannter "grüner" Wasserstoff. Die Windenergie kann im Gegensatz zur Solarenergie nicht am Ort der Erzeugung genutzt werden, da die Windkraftanlagen fast immer weit entfernt von den Stromverbrauchern stehen. Die größten deutschen Onshore-Windparks stehen im Norden und Osten - gibt es in den anderen Regionen wirklich keinen Platz? Im Jahr 2019 musste eine Strommenge von 6.482 GWh von den Netzbetreibern abgeregelt werden, 19 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Ein Ökostromverbrauch ist nicht möglich,
Seit dem Jahr 2000 gibt es zwar eine Begrenzung der Einspeisevergütung auf 20 Jahre, aber die Kraftwerke müssen sich überlegen, wie sie wirtschaftlich weiterarbeiten können. Danach müssen die Betreiber einen Abnehmer für die Direktvermarktung des Stroms finden, was aber am Repowering scheitern würde.
Kompletten Artikel anzeigen
Windenergie und Wasserstoff vereint für den Klimaschutz
Wasserstoff gilt als DIE Lösung für die Energiewende. Windenergie ist leistungsstark, nutzt aber ihr Potential nicht vollständig aus. Die beiden müssten sich doch zusammenbringen lassen, um die Dekarbonisierung voran zu bringen. Schließlich ist nur “grüner” Wasserstoff, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien produziert wird, wirklich hilfreich gegen den Klimawandel.
In diesem Beitrag habe ich mich mit beiden Themen beschäftigt und untersucht, wie sie gemeinsam Energiewende und Klimaschutz voranbringen können. Drei Beispiele zeigen, dass dieses Zusammenspiel sich bereits in der Erprobung befindet und auch schon umgesetzt wird.
Wasserstoff – wirklich die Antwort auf alle Fragen?
Wasserstoff als Energieträger wird in vielen Diskussionen und Berichten als DIE große Lösung für die Energiewende angesehen. Generell ist Wasserstoff ein hervorragendes Speichermedium und lässt sich in passenden Leitungen und Behältern gut transportieren. Damit wäre die Energie auch jederzeit verfügbar, unabhängig von Tages- und Jahreszeiten oder Wetterverhältnissen.
Aber Wasserstoff kann nur einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn für die Herstellung in der Elektrolyse Strom aus erneuerbaren Energien genutzt wird – der sogenannte “grüne” Wasserstoff. Alle anderen Wege zur Erzeugung sind eher schädlich für unser Klima.
Für die Erzeugung des Wasserstoffs wird Strom aus erneuerbaren Energien benötigt, hauptsächlich Wind- und Solarenergie. Damit steht die direkte Verwendung des erzeugten oder gespeicherten Stroms im Wettbewerb zur Nutzung des Wasserstoffs. In vielen Fällen ist es jedoch effizienter, Strom direkt zu nutzen – ob für die Elektromobilität oder in Wärmepumpen.
Der Wirkungsgrad für die Elektrolyse liegt zwischen 60 und 70 Prozent. Wenn wir aus dem Wasserstoff in einer Brennstoffzelle Strom erzeugen, beträgt der Wirkungsgrad für diesen Schritt 60 bis 80 Prozent. Das bedeutet, dass wir für grünen Wasserstoff als Stromspeicher mindestens dreimal mehr Strom aus erneuerbaren Energien einsetzen müssen. Entsprechend steigen auch Aufwand und Kosten.
Einige industrielle Prozesse lassen sich nicht elektrifizieren oder benötigen eine direkte Verwendung von Wasserstoff. Die Chemieindustrie nutzt heute schon große Mengen Wasserstoff für die Herstellung von Ammoniak. Grüner Wasserstoff kann fossiles Erdgas ersetzen.
Windenergie ist ein Teil der Dekarbonisierung mit Problemen
Die Stromerzeugung aus Windenergie ist, neben der Photovoltaik, ein wichtiger Bestandteil der Dekarbonisierung. Strom aus Windenergieanlagen hatte 2020 einen Anteil von 27 Prozent an der deutschen Stromversorgung und war damit wichtigste einzelne Energiequelle im deutschen Strommix.
Doch Windenergie kann, im Unterschied zur Solarenergie, nicht am Ort der Erzeugung genutzt werden, denn fast immer stehen die Windräder weit weg von den Stromverbrauchern. Die Anwohner sollen nicht durch die Geräusche der Rotoren belästigt werden. Einige politische Akteure legen deswegen große Mindestabstände von 1 bis 2 km zu Wohngebieten fest. Ein weiterer Grund, warum sie hauptsächlich in dünn besiedelten Regionen stehen.
Ungleiche räumliche Verteilung
Die Folge ist eine ungleiche räumliche Verteilung der Windenergie in Deutschland. Am Windmonitor des Fraunhofer Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik sehen wir die räumliche Verteilung in Deutschland und die durchschnittliche lokale Windgeschwindigkeit. Die größten deutschen Onshore Windparks stehen im Norden und Osten – ist in den anderen Regionen wirklich kein Platz?
Einspeisemanagement sorgt für ausgefallene Energie
Ein weiteres Problem der Windenergie ist das Einspeisemanagement. Diese Abregelung von Strom aus erneuerbaren Energien durch den Netzbetreiber ist erforderlich, wenn einzelne Abschnitte im Stromnetz überlastet sind und das Angebot an Strom nicht abgenommen werden kann. Windenergieanlagen sind von dieser Maßnahme besonders betroffen – sie werden dann aus dem Wind gedreht, um den Antrieb der Turbine und damit die Stromerzeugung zu stoppen.
2019 musste eine Strommenge von 6.482 GWh von den Netzbetreibern abgeregelt werden, 19 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Davon entfielen 78 Prozent auf Windkraft an Land und 18 Prozent auf Offshore Windenergie. Nur vier Prozent der abgeregelten Anlagen waren keine Windenergieanlagen (Quelle: Monitoringbericht 2020 der Bundesnetzagentur).
6,48 Terawattstunden sauber erzeugter Strom hätten in anderen Anwendungen zum Einsatz kommen und die Nutzung fossiler Energien vermeiden können. Hinzu kommen Kosten von mehr als 700 Millionen Euro, die an Anlagenbetreiber als Entschädigung gezahlt werden mussten.
Nutzung von Post-EEG Anlagen
Seit 2000 gibt es das Erneuerbare-Energien Gesetz EEG. Da es die Einspeisevergütung auf 20 Jahre begrenzt, verlieren ältere Windenergieanlagen diesen Anspruch. Anschließend müssen sich die Betreiber Gedanken machen, wie sie den Weiterbetrieb wirtschaftlich aufrecht erhalten können.
Ein Eigenverbrauch des Stroms, wie bei Photovoltaikanlagen, ist nicht möglich. Die Windenergieanlagen sind direkt an das Stromnetz angeschlossen und stehen zu weit von den nächsten Verbrauchern entfernt. Daher müssen die Betreiber einen Abnehmer für die Direktvermarktung des Stroms finden. Alternativen wären ein Repowering, das aber an der Genehmigung scheitern würde, oder der Abbau der alten Anlagen.
Wie Wasserstoff der Windenergie helfen kann
Jetzt kommt der anfangs erwähnte Wasserstoff ins Spiel. Mit der Erzeugung von grünem Wasserstoff können wir die genannten Probleme der Windenergie nicht vollständig lösen, sie aber mindestens verringern. Hier kann die Elektrolyse sinnvoll eingesetzt werden und Wasserstoff einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten.
Grafik: Greenpeace Energy eG
Erzeugung von Wasserstoff bei Netzengpässen
Die ungleiche räumliche Verteilung der Windenergie erfordert ausreichende Kapazitäten in den Netzen für den Transport des Stroms zu den Verbrauchern. Reichen die Kapazitäten nicht aus, kommt es zu Engpässen im Stromnetz und als Folge müssen die Netzbetreiber Windenergieanlagen abregeln.
Warum nutzen sie dann nicht lieber den Strom für die Elektrolyse und erzeugen sauberes Gas? Die Elektrolyseure lassen sich je nach Bedarf einsetzen und entsprechend regeln. Die Windenergieanlagen können weiter laufen und die Energie bleibt nicht ungenutzt. Der erzeugte Wasserstoff kann in ein Netz eingespeist oder in Behältern gespeichert und transportiert werden, um an anderer Stelle fossiles Gas einzusparen.
Erzeugung von Wasserstoff mit alten Windenergieanlagen
Alte Windenergieanlagen, die keine Einspeisevergütung mehr erhalten (Post-EEG), benötigen einen Direktvermarkter oder eine andere Lösung für die Fortführung des Betriebes, da sie sich sonst nicht mehr wirtschaftlich betreiben lassen. Die Elektrolyse zur Erzeugung von grünem Wasserstoff bietet sich als sicherer Abnehmer an. So kann die CO2-neutrale Stromerzeugung weiter betrieben werden.
Nach Angaben des Bundesverband WindEnergie schätzt die Bundesregierung den Bedarf an sauberem Strom für die Erzeugung von grünem Wasserstoff auf 20 TWh pro Jahr. Einen hohen Anteil davon können die sogenannten Post-EEG Anlagen liefern.
Voraussetzung für ein funktionierendes Geschäftsmodell ist aber auch eine Befreiung des Stroms von EEG-Umlage und Netzentgelten, so Sabine Peter, Präsidentin des Bundesverband Erneuerbare Energien. Eine Befreiung des Stroms von der EEG-Umlage gibt es seit Sommer 2021, aber bisher gilt sie nicht für Anlagen, die eine Förderung nach dem EEG erhalten haben.
Beispiele aus der Praxis zur Verbindung von Wasserstoff und Windenergie im vollständigen Artikel.


